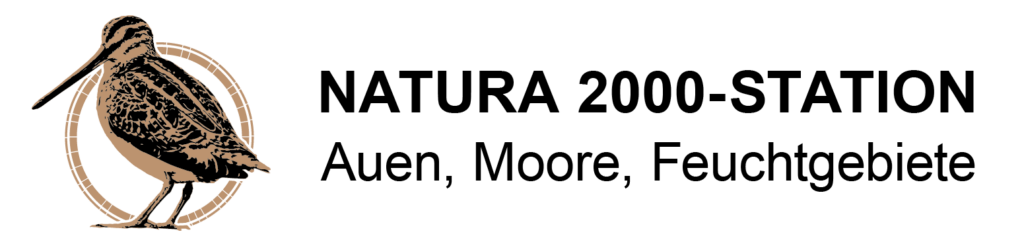Unsere
Aufgaben
Die praktische Umsetzung der Bemühungen der Natura 2000-Stationen für den Erhalt und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der Lebensraumtypen und Anhangarten der FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie basiert auf der Initiierung und Beantragung von Förderprojekten. Zeitlich und räumlich stark begrenzte Maßnahmen werden meist über NALAP-Projekte realisiert, während größere und übergreifende Vorhaben häufig im Rahmen von ENL-Projekten auf der Förderung von ELER und EFRE basieren. Eine Übersicht über die Fördermöglichkeiten finden Sie hier.
Diese Vorhaben werden maßgeblich durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz nach den Richtlinien „Förderung von Vorhaben zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ (ENL) und „Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Thüringen“ (NALAP) finanziert. Träger der durch die Natura 2000-Station „Auen, Moore, Feuchtgebiete“ initiierten Projekte ist die NfGA. Eine Übersicht über die zentralen Projekte der NfGA erhalten sie hier (Projektseite aktuell in Überarbeitung).
Zentrale Projekte
Synergie GUV & Natura 2000
Im Jahr 2020 wurden in Thüringen 20 Gewässerunterhaltungs-verbände (GUVs) gegründet, welche für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und die Umsetzung der Wasserrahmen-richtlinie (WRRL) verantwortlich sind. Die Anforderungen dieser und die der FFH-RL überschneiden sich vielerorts. Eine Abstimmung und die Zusammenarbeit beider Disziplinen sind dabei unerlässlich.
Ziel des Projektes ist es, durch strukturschaffende Maßnahmen die Qualität des Fließgewässer-Lebensraumtyps 3260 und somit die Habitate verschiedener FFH-Anhangaten mit Wasserbezug, wie Groppe, Bachneunauge, Bitterling und Bach- und Flussperlmuschel zu verbessern und möglichst lange, zusammenhängende Fließgewässerstrecken ökologisch aufzuwerten. Dies soll in Zusammenarbeit mit den örtlichen GUVs geschehen, wodurch die Synergie zwischen FFH-RL und WRRL genutzt wird. Die gegenseitige Beratung und gemeinsame Umsetzung soll eine vertrauensvolle Kooperation der beiden Akteure am Wasser fördern.
Pfützen für Pioniere
Die Natura 2000-Station AMF setzt sich im Rahmen unterschiedlicher Projekte schon seit 2019 kontinuierlich für die Pionieramphibien Thüringens, immer mit einem lokalen Schwerpunkt, ein. Die dazu zählenden Arten Geburtshelferkröte, Kreuzkröte, Wechselkröte und Gelbbauchunke sind u.a. durch veränderte Witterungsverhältnisse und Flächennutzung, großräumige Flächenentwässerung, fehlende Primärhabitate und Landschaftsdynamik sowie isolierte Populationen heute alle vom Aussterben bedroht. Das Projekt setzt sich nun thüringenweit für die drei erstgenannten Arten ein, versucht diese lokal zu erhalten und Stück für Stück wieder zu vernetzen. Maßnahmen reichen von Entbuschungen, über die Anlage von natürlichen Tümpeln und Rohbodenflächen bis hin zur Nutzung von Betonbecken als effektive Soforthilfemaßnahme.
Reptilienwiesen Thüringen
Die Leitarten des Projekts, Schlingnatter, Kreuzotter, Zaun- und Waldeidechse, sind maßgeblich alle durch denselben Faktor bedroht: Den Verlust ihrer Lebensräume.
Alle drei Arten benötigen halboffene, strukturreiche Habitate wie natürliche Waldränder und extensive Wiesen mit Gebüschsäumen, Moore, Mager- und Trockenrasen, Geröllhalden und Trockenmauern oder (Feld-)Heiden. Maßgeblich ist der Wechsel aus offenen, lockerbödigen Bereichen mit dichter bewachsenen Abschnitten sowie das Vorhandensein von Sonnen- und Eiablageplätzen.
Derartige Lebensräume sind in unserer intensiven Kulturlandschaft selten geworden.
Um die Arten also mittelfristig bei uns zu halten, gilt es, Habitate zu pflegen, aufzuwerten und wo möglich, neu zu erschließen. Dafür setzt sich das Projekt praktisch in ganz Thüringen ein.
1001 Teich(e) in Dreba-Plothen & Pennewitz
Das ENL-Projekt 1001 Teich(e) befasst sich vorrangig mit der Teichgebietsentwicklung in den überregional bedeutsamen Teichgebieten bei Pennewitz und Dreba-Plothen. Die beiden Gebiete sind für Teichwirtschaft, als Vogelrastplätze, zur Erholung sowie für eine Vielzahl gefährdeter Amphibienarten und Insekten in Thüringen von großer Bedeutung. Sie bieten bzw. boten entscheidende Habitatstrukturen für die Arten Nördlicher Kammmolch, Knoblauchkröte, Europäischer Laubfrosch, Moorfrosch und Kleiner Wasserfrosch. Die Abstimmung der verschiedenen Anforderungen der involvierten Interessensvertreter an die Gebiete aufeinander, aber vor allem konkrete Maßnahmenumsetzungen in Fortpflanzungsgewässern und Landhabitaten bezeichnen das Projekt.
Auenhabitatentwicklung Ostthüringen
Im Rahmen des ENL-Projekts sollen Auenhabitate durch Strukturanlage für Arten der strukturreichen Pionierstandorte aufgewertet werden. Dabei sollen schwerpunktmäßig in ausgewählten Überschwemmungsgebieten des Landkreises Altenburger Land (Modellregion) Maßnahmen ergriffen werden, um die Auen von z.B. Pleiße, Sprotte und Wyhra wieder als strukturreiche Primärhabitatstandorte, zu entwickeln. Diese sollen einen Verbund mit den aktuellen Sekundärstandorten erreichen, welcher gemeinsam mit weiteren ENL-Projekten außerhalb der Auen bzw. Überschwemmungsbereiche erarbeitet werden. Der Fokus liegt hierbei auf den Amphibienarten aus dem Prioritätenkonzept Thüringens.
Habitatflächensicherung Biberauen
Das ENL-Projekt kümmert sich auf vier ausgewählten Flächen Thüringens um die Flächensicherung für den Biber und weitere auf überschwemmte Auen angewiesenen Arten. Ziel des Projekts ist die Flächensicherung und -entwicklung von wertvollen Auenflächen, welche bereits durch den Biber überstaut wurden. Dies soll durch Flächenkaufvorbereitung, -planung und -begleitung sowie wo möglich durch Maßnahmenplanung ggf. -umsetzung realisiert werden. Der Europäische Biber (Castor fiber) ist im Anhang II und IV der FFH-Richtlinie gelistet und dadurch streng geschützt. Im Jahr 2007 hat der semiaquatische Nager nach seiner Ausrottung endgültig den Weg zurück nach Thüringen gefunden. Er stellt Flächenbewirtschafter und Behörden häufig vor große Herausforderungen, agiert jedoch auch kostenlos als effektiver Landschaftsgestalter.
Aktionsplan Wechsel- und Kreuzkröte Ostthüringen
Den Pionieramphibien in Thüringen setzten seit Jahren Trockenheit, Flächenentwässerung, fehlende Vernetzung und Dynamik in der Landschaft zu. Der Raum um das Altenburger Land und Greiz war ehemals ein Hotspot für die beiden heute stark gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Arten Wechsel- und Kreuzkröte. Beide haben einen sehr charakteristischen Ruf der weithin hörbar ist und sind auf temporäre Flachgewässer angewiesen. Seit dem Sommer 2022 setzt sich das Projekt dafür ein den Erhaltungszustand der wenigen verbliebenen Vorkommen durch Sofortmaßnahmen lokal zu verbessern, sodass sie wieder öfter hörbar sind. Dies soll außerdem dazu beitragen mittel- und langfristig durch Biotopverbund die Grundlage für ein funktionierendes Populationsnetz zu schaffen.
Aktionsnetz Gelbbauchunke Jena & Saale
Östlich des Nationalparks Hainich sind nur noch zwei kleine Populationen der in Thüringen vom Aussterben bedrohten Gelbbauchunke bekannt. Mit ihren charakteristischen Merkmalen wie die herzförmigen Pupillen und einem gelb gefleckten individuellen Bauchmuster sind diese kleinen Froschlurche auf kleine stark besonnte Pfützen in Waldnähe angewiesen. Solche Kleinstgewässer werden in unserer stark genutzten Landschaft nur noch selten zugelassen. Als sekundär genutzte Laichgewässer dienten beispielsweise tiefe Fahrspuren auf Feldwegen. Ehemals nutzte sie jedoch unter anderem Pfützen auf überstauten Aueflächen und Wildschweinsuhlen. Für den Erhalt und die Stärkung der letzten Vorkommen um Jena und entlang der Saale soll ab dem Sommer 2022 ein Netz aus Habitat- und Trittsteinflächen errichtet werden.
Aktionsplan Geburtshelfer- und Kreuzkröte
Das Projekt setzt sich seit 2019 dafür ein den Erhaltungszustand der verbliebenen Geburtshelferkrötenpopulationen in Westthüringen durch Sofortmaßnahmen zu verbessern. Dies soll außerdem dazu beitragen mittel- und langfristig durch Biotopverbund die Grundlage für ein funktionierendes Populationsnetz zu schaffen. Die Art erreicht in Thüringen ihre nordöstliche Verbreitungsgrenze und ist hier vom Aussterben bedroht.
Seit 2022 zählt außerdem die ebenfalls vom Aussterben bedrohte Kreuzkröte mit zu den Schützlingen des Projekts.
Beratungsstelle Artenschutz
in Thüringer Abbaustätten
Seit 2017 ist es das Anliegen des Bergbauberatungsprojekts Betreiber aktiver Abbaustätten in Thüringen hinsichtlich einer ökologisch verträglichen Betriebsweise zu beraten und möglichen Interessenskonflikten vorzubeugen. Bergbaulandschaften bieten häufig den Charakter von Pionierstandorten mit Rohbodenflächen, spärlicher Vegetation und flachen Wasseransammlungen. Von diesen spärlich gesäten Bedingungen angezogen, suchen sich Pionierarten wie die Wechsel- und Kreuzkröte häufig solche Flächen als Ersatzhabitate für ihre nicht mehr vorhandenen natürlichen Lebensräume aus. Der aktive Abbau schafft demnach wertvolle Biotopflächen und ist bei geeignetem Management meist sehr gut mit dem Artenschutz vereinbar. Ziel ist die einfache Integration von regelmäßigen Maßnahmen in den Betriebsablauf, ohne diesen zu stören oder die wirtschaftlichen Ziele der Firmen zu beeinträchtigen.
Maßnahmen zum Amphibien- und Wiesenbrüterschutz in der Werra-Aue bei Creuzburg
In der Projektlaufzeit von 2020 bis 2022 wurde in einem Abschnitt der Werra-Aue ein Refugium für bedrohte Amphibienarten und Wiesenbrüter auf insgesamt 46 ha zusammenhängender Fläche dauerhaft gesichert. Hierzu gehören maßgeblich die deutliche Erweiterung der bestehenden Mischbeweidung unter anderem mit Wasserbüffeln und die initiale Anlage von Kleingewässern in der Weidefläche.
Pilotprojekt Ökologisches
Trassenmanagement Thüringen
Ein in den westlichen Bundesländern schon seit Jahren bekanntes und angewandtes Konzept, das ökologische Trassenmanagement, soll jetzt auch in Thüringen bekannt werden. So ist es bisher beispielsweise gängige Praxis Waldflächen unter Trassen in einem regelmäßigen Turnus zu Mulchen und damit Lebensräume immer wieder zu zerstören – das geht auch anders. Seit 2021 zielt das Beratungsprojekt darauf ab, in enger Zusammenarbeit mit den Betreibern von Leitungstrassen energiewirtschaftlich genutzte Flächen auf ökologisch sinnvolle Art und Weise nachhaltig zu entwickeln. Hierbei werden die Trassen strukturreicher gestaltet, indem durch entsprechende Pflege Gehölzstrukturen unterschiedlicher Altersklassen entstehen, durch gezielte Mahd oder Beweidung Grünlandtypen erhalten werden oder durch Neuanlage von Steinhaufen, Totholzhaufen, Rohbodenstellen und Feucht- bzw. Gewässerflächen diversen Tieren Habitate geboten werden.